![]() |
Die Schokoladenhersteller „Mast Brothers“ aus Williamsburg, USA |
Der Satz “Wir brauchen innovative Ideen“ ist heutzutage derart standardisiert und abgedroschen, dass die wahrhaftige Bedeutung des Wortes „innovativ“, nämlich einfallsreich, fantasievoll, ideenreich, originell oder schöpferisch, beinahe nicht mehr herauszuhören ist. Doch, dass auch heute der Urgedanke der Innovativität noch angestrebt werden kann, zeigt das Buch „ A Delicious Life – New Food Entrepreneurs“. Das englischsprachige Buch des „gestalten“-Verlags versammelt die skurrilsten, abgefahrensten und eben innovativsten Restaurants, Take-A-Way-Buden und Produkte-Tüftler. Die Bilder von vergessen geglaubten Zubereitungsarten, den Machern in Aktion oder der Gästen beim Gaumenschmaus, machen „A Delicious Life“ beinahe schon zum selbstsprechenden Bildband. Kurze Biografien oder Unternehmensbeschreibungen ermöglichen wiederum mehr über Entstehung, Arbeitsplatz und Geschäftsidee der Schöpfer zu erfahren und natürlich in welchem Land und in welcher Stadt, man ihre Köstlichkeiten antreffen kann.
Einige der kreativsten „New Food Entrepreneurs“ aus dem 240-seitigen Werk:
„Was die Mexikaner können, können wir schon lange“, dachten sich Denise Drenkelfort und Torsten Alberts, als sie die Idee für ihre „Paletas – Berlin“ hatten. Die originale mexikanische Paleta ist ein Eis am Stiel, welches aus frischen Früchten, Rahm und Milch produziert wird. Frei von Geschmacksverstärkern und Zusatzstoffen. Die zwei Berliner waren so begeistert von der traditionellen Technik fernab von Industrieware, dass sie an ihren eigenen Kreationen aus regionalen Früchten, Gemüse, Kräuter und sogar Blumen zu tüfteln begannen. Heute sind ihre kreativen Kombinationen wie das Gurken-Zitrone-Ingwer-, das Himbeere-Hibiskus- oder das luxuriöse Erdbeer-Champagner-Eis stadtbekannt.
Wer sich schon die Finger leckt findet die Adresse unter:
Wenn es eine moderne Meisterin der guten Taten gibt ist es sicherlich die Niederländerin Henriëtte Waal. Seit es immer mehr Leute in die Stadt zieht, hat sich die niederländische Landschaft verändert. Um wieder Leben aufs Land zu locken, wurde das Projekt „Werkplaats Buijtenland“ ins Leben gerufen. Die Künstlerin und Designerin Henriëtte Waal hat neben einer Brauerei für Sauren Most um die lokalen Apfelbauern zu unterstützen, ein kleines Gästehaus mit mobiler Küche und Freiluft-Dusche kreiert. Zusammen mit anderen Designern plant sie nun weitere interaktive Projekte um vor allem den Stadtmenschen die Natur wieder näher zu bringen in dem man draussen zusammen etwas erlebt.
Ein weiterer niederländischer Tüftler ist Casper Tolhuisen. Der Produktedesigner arbeitet mit alltäglichen Objekten wie Blumentöpfen, Pfannen, Geschirr in dem er sie mit (mit starkem Aluminium-Klebeband) neu zusammenbastelt. Seine Gerätschaften, die im eigenen Studio entstehen, sollen es ermöglichen vergessene, alte Zubereitungsmethoden, wie z.B. eine Art Kombination zwischen Grillen und Dampfgaren aufleben zu lassen. So hat er einen Grilltopf gebaut, der an den traditionellen Türkischen Guvec angelehnt ist und in dem man Gemüse, Fleisch, Linsen sowie Früchte gleichermassen gut garen kann. Gerätschaften und Rezepte für würzige Speisen können im „Studio Caspar Tolhuisen“ bestellt werden.
Unter: www.studiocaspertolhuisen.nl
In der Stockholmer Nytorgsgatan bleibt man gerne etwas länger zum Schaufensterbummeln. Denn wenn man den Frauen in „Pärlans Konfektyr“ bei der Anfertigung der ökologischen Konfekt-Leckereien zusieht, läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Das Angebot des „Pälans Konfektyr“ bestehend aus Karamells, Toffees und Fudges, katapultieren einem direkt in die Goldene Ära der Konfektbäcker in den 30ern zurück. Doch Besitzerin Lisa Ericson bemüht sich neben den altbewährten Rezepturen auch Kreationen mit verschiedenen Nüssen, fremdländischen Gewürzen oder frischen Beeren zu erproben um ihren Kreationen eine moderne Note zu verleihen.
Wie, wo, was unter: www.parlanskonfektyr.se
Pizza aus dem Holzofen ist keine Sensation mehr. Doch schmeckt diese immer noch am besten wenn sie frisch aus dem selbigen Ofen kommt. „Weshalb also anstelle eines Nach-Hause-bring-Services, die Pizza nicht gerade vor der Haustüre des Kunden backen?“, hat sich Jon Darsky wohl gefragt. In seinem transatlantischen Frachtcontainer auf Rädern, namens „Del Popolo“, kreiert er rustikale Holzofen-Pizzen, die mit Zutaten aus der Region rund um die Bay Area in San Francisco belegt werden. Seine Pizzas sollen aber nicht nur regional und frisch sein, sondern auch erschwinglich. Was sich im Namen „Del Popolo“, was auf Italienisch „für die Bevölkerung“ heisst, widerspiegelt.
Wer mal vorbeischauen will, findet Informationen auf: www.delpopolosf.com
Zwar ist er Verfechter der experimentellen Esskultur, doch wiederholt Dan Barber auch gerne, dass es Aufgabe eines Kochs sei, sich um die Gesundheit und die Erhaltung des guten Geschmacks Gedanken zu machen. So ist es Barber ein Anliegen, dass die einzelnen amerikanischen Staaten den Gedanken des Selbstversogers wieder aufnehmen, anstatt Getreide und Gemüse von Süden nach Norden und Osten nach Westen zu karren. Um dies zu ermöglichen, braucht es laut Chefkoch Barber Projekte wie die Wiederherstellung der „Empire State’s grain industry“, an dem Bauern von New Mexico bis Pennsylvania beteiligt sind. Barber selbst serviert im „Blue Hill“, Restaurant im „Stone Bars Center“ einer Institution, die als Austauschplattform für Agrarwissenschaftler, Studenten und weitere Interessierte gilt, nur Produkte der Blue Hill Farm in Barrington, Massachusetts, und einigen weiteren lokalen Bauernhöfen.
Mehr Informationen unter: www.bluehillfarm.com
Ein abenteuerliches Katz-und-Maus-Spiel mit dem eigenen Essen erwartet einem, wenn man bei „The Social Act“ zu Gast ist. Bo Lindegaard und Lasse Askov aus Kopenhagen gründeten im Jahr 2012 ihr Restaurant, um Essen wieder als kulturelles Gut und nicht nur als Nahrungseinnahme zu betrachten. Alle zwei Wochen ist ihr Lokal für rund 14 Gäste geöffnet, welche ein ungewöhnliches Neun-Gang-Menu erwartet. Denn alle Gänge werden auf spielerische Weise arrangiert. So muss man sich seine Wurst mal selbst braten oder die Sauce für seine Dimsums aus einer Kartontischplatte herausschneiden. Langweilig wird’s einem im „The Social Act“ jedenfalls nie.
Neugierige finden weitere Infos unter: www.thesocialact.dk
![]()
Weshalb unter Öffnungszeiten „Sunny Days“ steht verwundert beim „Lapin Kulta - Solar Kitchen Restaurant“ nicht. Gibt’s keine Sonne, bleiben die Teller leer. Erschaffer des Lapin Kultas ist Martί Guixé, der als Vater des Spanischen Food-Designs seit den 90ern bekannt ist. Da Guixé mehr am Kochen selbst und weniger am Endresultat interessiert ist, begann er sich für Solar-Küchen zu interessieren. Obwohl man denken könnte, dass sich die Kochprozesse, die durch Solarenergie ermöglicht werden, nicht von gewöhnlichen unterscheiden, stiess Guixé auf erstaunliche Ergebnisse. Der Geschmack und die Konsistenz der Speisen differenzierten täglich. Getrieben von der Neugier entwickelte Guixé schliesslich das Konzept zum Solar-Restaurant um diese Experimentierfreude auch weiter zu geben. Die Tatsache, dass die Restaurantsöffnungszeiten vom Wetter abhängig sind, gefiel dem Spanier vom Beginn an. Die Idee, die Flexibilität seiner Gäste zu testen, schien ihm in der heutigen schnelllebigen Zeit genau die richtige.
Wie, wo, was genau unter: www.guixe.com
A Delicious Life – New Food Entrepreneurs
Ist erhältlich bei Orell Füssli für 55.- SFr










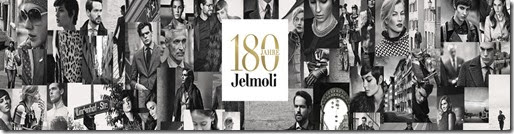









































.jpg)













